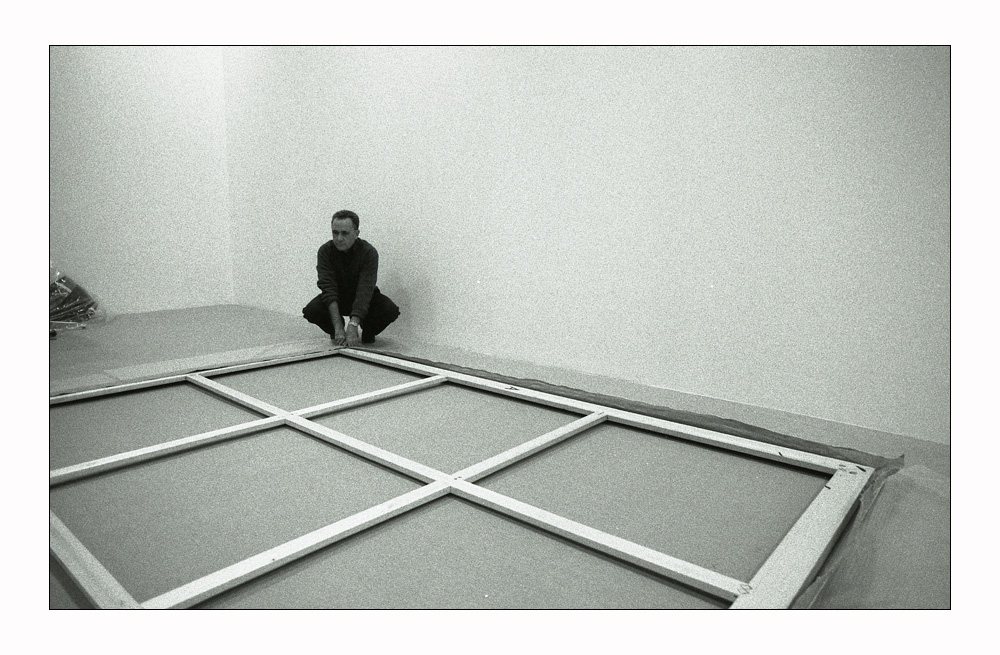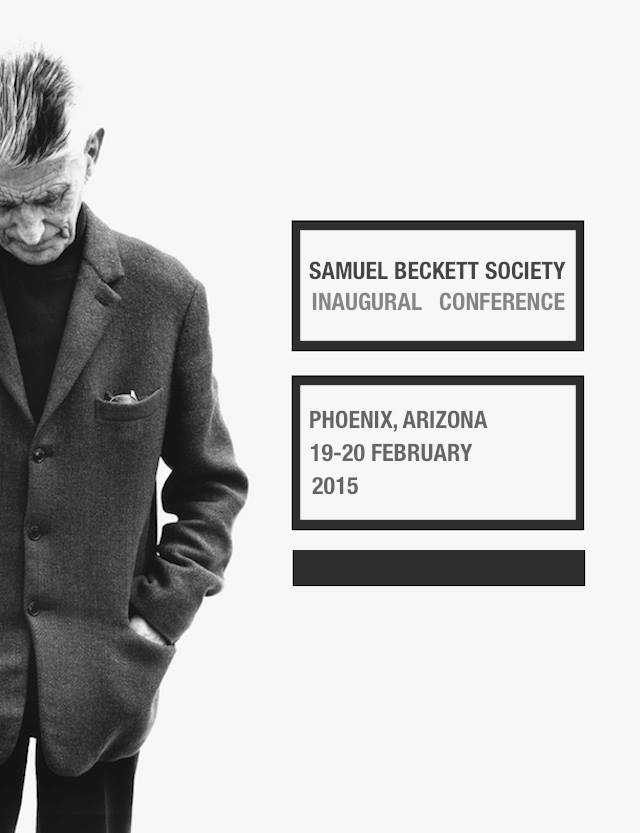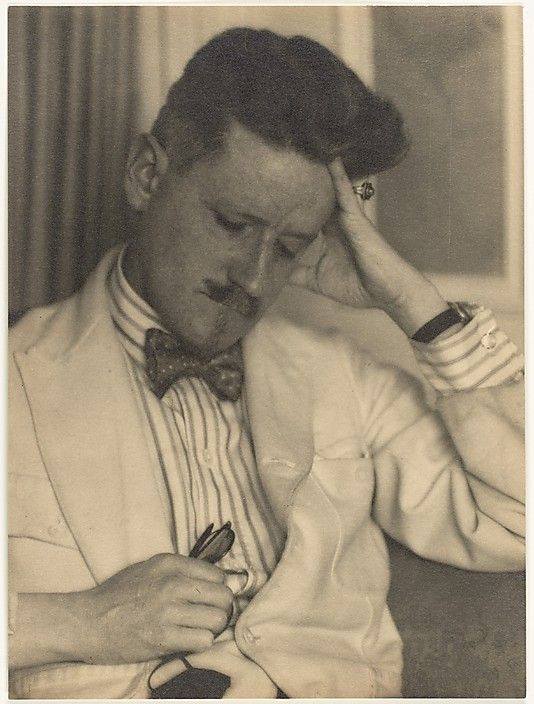Ein Beitrag von Michael Girke
Ein Leben lang Todfeind
.
Notizen „Das Buch gegen den Tod“ erinnert an die große Eleganz im Denken und Schreiben von Elias Canetti
Anfang der 1970er Jahre gehen Elias Canetti und Thomas Bernhard öfters gemeinsam spazieren, sie diskutieren viel. Doch bald geraten die beiden in heftigen Zwist, den sie auch öffentlich austragen. In dem nun posthum erscheinenden Buch mit teils unveröffentlichten, teils veröffentlichten Notizen Canettis ist ein Brief abgedruckt, der den Grund dafür nennt. Bernhard habe etwas gänzlich Unakzeptables gesagt, und zwar: Der Tod sei das Beste, was wir haben.
Beim Thema Tod zog der „Todfeind“ Canetti, wie er sich selber stets nannte, eine Grenze, die nicht überschritten werden durfte. Wer es tat, galt als Antipode und wurde entsprechend behandelt. Und so ist Canettis Buch nicht ein weiteres über den Tod, sondern tatsächlich eines gegen ihn. Und das heißt auch: eines gegen all jene, die Canettis Auffassung nach dem Tod zuarbeiten.
Canetti liest, um den Tod sowie den kulturellen Umgang damit besser zu verstehen, Dichter, Philosophen, ganze Bibliotheken mit Werken über Religionen. Gläubig ist der Skeptiker nicht, doch Mythen faszinieren ihn, schon gar von ihnen inspirierte Kunstwerke: „Ich habe mein Zimmer mit Matthias Grünewald behängt, denn mein Schmerz hat seinen Laut noch nicht gefunden. So sagt er meinen Schmerz. Für diesen Zauber schäme ich mich nicht, ich habe nie etwas mehr geliebt und verehrt wie Grünewald.“
Dass der Tod Nobelpreisträger so vom Tod gefesselt war, hat auch biografische Gründe. Der Vater stirbt, da ist Canetti sechs Jahre alt; die geliebte und bewunderte Mutter, der er auch seine Passion für die Literatur verdankt, siecht auf dem Sterbebett dahin. Canettis Wunsch nach Unsterblichkeit hat aber auch mit allgemeinen Einsichten in das menschliche Jammertal zu tun: „Wäre aber der Tod gar nicht da, so könnte einem nichts wirklich misslingen; in immer neuen Versuchen könnte man Schwächen, Unzulänglichkeiten und Sünden wiedergutmachen. Die unbegrenzte Zeit gäbe einem unbegrenzten Mut.“ In der Tat, unsere kurze Lebensspanne mag ein Grund sein, warum wir aus schlimmen Verfehlungen, sprich aus unserer Geschichte so wenig lernen. Nur, was folgt daraus? Für Canetti nichts weniger, als dass die Welt eine ganz andere werden muss.
Mit seinen Aufzeichnungen über den Tod beginnt er 1942 in seinem Londoner Exil, in das er vor den Nazis geflohen war. Die Aufzeichnungen meinen mehr als das physische Sterben, zu dem alle Wege führen, sie prangern auch das grausame Töten der Tiere an. Canetti fühlte mit ihnen, malt sich Szenen aus, in denen Kühe oder Schafe ihren Sanftmut überwinden und die Schlächter in die Flucht schlagen.
Als Canetti während des Zweiten Weltkrieges von der Vernichtungswut der Nazis gegenüber den Juden und den Gaskammern hört, begrüßt er die Ausradierung deutscher Städte durch alliierte Bomber. Der Ächter des Mordens als dessen Fürsprecher? Canetti erschrickt auch vor sich selbst: „Ich aber will dem Moloch mein Herz nicht zum Fraß vorwerfen. Ich will nicht hassen. Ich hasse den Hass.“ All das sind Zeugnisse eines Denkers, der den Humanismus selbst dann bewahren will, wenn ihn jegliche Ethik hinwegzufegen droht. Als seinen größten geistigen Widersacher sieht er Nietzsche an. Dessen Lust am Sich-Messen und Übertreffen nennt er albern und zerstörerisch, den Nietzschekult in Deutschland findet er fatal. Canetti will mit seiner Literatur vor der Ansteckung mit Größenwahn impfen.
Klaus Theweleit hat darauf verwiesen, dass Canettis Hauptwerk Masse und Macht eines der besten Bücher über den Nationalsozialismus sei, weil Hitler mit keinem Wort erwähnt wird, vielmehr stecke dieser in den Massen, er verkörperte ihre Erwartungen und Energien. Was den Rang angeht, kann man Das Buch gegen den Tod durchaus an seine Seite stellen, enthält es doch viele der Ideen, die Canetti im Essay systematisch ausgearbeitet hat. Überdies besitzt diese Sammlung von Glossen, Aphorismen und Notizen einen großen Vorzug: Die darin gesammelten Aufzeichnungen entstanden in einem plötzlichen, blitzartigen Ausbruch, so dass Spontaneität und die Emotion des Moments Eingang in die Form fanden. Schreiben, das aus den gewundenen Tiefen des Herzens kommt.
Quelle:
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/ein-leben-lang-todfeind